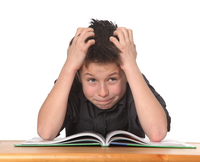DHCP-Server Kea

Adressjockey
Kea wurde als Nachfolger für den in Enterprise-Netzwerken seit 1999 häufig verwendeten Open-Source-DHCP-Server "ISC DHCP" des Internet Systems Consortium konzipiert. Der DHCP-Server kam vor kurzer Zeit in der Version 1.8.1 heraus [1] und steht für Linux-, Unix- und macOS-Betriebssysteme zur Verfügung. Der Dienst verfügt über einen modularen Aufbau. Beispielsweise gibt es separate Daemons für DHCPv4 und DHCPv6 sowie für die dynamische DNS-Registrierung.
Die Serverkonfiguration fußt auf einer JSON-basierten Datenstruktur. Konfigurationsänderungen bedürfen, mit Ausnahme eines Schnittstellenwechsels, keines Dienstneustarts. Dies war beispielsweise eines der zentralen Kriterien für einen der Early Adopter des Projekts: Facebook. Der Social-Media-Konzern setzte den Vorgänger ISC DHCP gemäß eigenen Aussagen für die Provisionierung der Betriebssysteme von Bare-Metal-Servern und Out-of-Band-Managementsystemen ein.
Automatisierte Mechanismen waren mit statischen Konfigurationsdateien aber komplex zu implementieren und erforderten häufige Neustarts von Diensten, um die Änderungen übernehmen zu können. Zusätzlich waren erweiterte
...Der komplette Artikel ist nur für Abonnenten des ADMIN Archiv-Abos verfügbar.