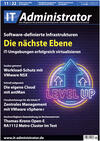Software-defined Networking im Überblick

Gut verknüpft
Der Siegeszug der Virtualisierung rollt unaufhörlich. Server machten den Anfang, dann folgten andere Komponenten, in den 2010er Jahren auch Netzwerke. Das Prinzip ist immer gleich: Physische Hardware und Software werden getrennt, bisher in Hardware gegossene Funktionen durch Software realisiert. Mehr Flexibilität und eine Aufweichung von festen Herstellerbindungen sind auch beim Software-defined Networking (SDN) der Lohn.
Und Flexibilität brauchen Provider und Unternehmen, um Technologien wie Remote, Mobile, Cloud und IoT, Edge-Computing, Virtuelle Realität, Container, Microservices und Service-Meshes optimal gestalten und nutzen zu können. Verbindungen sollen nicht mehr in Monaten, sondern in Minuten bereitgestellt oder in ihrer Qualität verändert werden. Zusätzliche Funktionen, etwa erhöhte Sicherheit, wollen Anwender bei Bedarf und lediglich für bestimmte Datenströme, Zeitabschnitte oder Strecken benutzen, nicht mehr pauschal buchen und bezahlen.
Schichtenmodell auch bei SDN
...Der komplette Artikel ist nur für Abonnenten des ADMIN Archiv-Abos verfügbar.